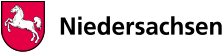Kein Hinweis auf erhöhte Strahlenbelastung
Presseinformation vom 16. Juni 2011 // Seit 30 Jahren Fernüberwachung von Abluft und Abwasser der Kernkraftwerke
Unabhängig von allen Diskussionen um einen Atomausstieg hatte und hat der NLWKN die vier niedersächsischen Kernkraftwerke fest im Blick: Mithilfe der Kernreaktor-Fernüberwachung werden die radioaktiven Stoffe in der Abluft und im Abwasser rund um die Uhr überwacht. „Dieses Fernüberwachungs-System als Teil der niedersächsischen Atomaufsicht läuft seit genau 30 Jahren, bisher hat es keinen Hinweis auf eine erhöhte Strahlenbelastung durch den Betrieb der Kernkraftwerke gegeben", zog Direktor Siegfried Popp Bilanz. „Eine Alarmierung würde erfolgen bei Überschreitung eines Genehmigungswertes, aber auch beim Ausfall wichtiger Messkomponenten oder Übertragungswege", sagte Popp bei der Vorstellung des Jahresberichts des NLWKN.
Neben der konkreten Messinstrumentierung in den Anlagen besteht die Fernüberwachung hauptsächlich aus einem komplexen Mess- und Informationssystem, mit dem täglich mehr als 100.000 Messwerte erfasst, bewertet und eben rund um die Uhr überwacht werden. Seit 2005 liegt die Verantwortung für die Fernüberwachung der Kernkraftwerke - Emsland, Unterweser und Grohnde sowie das im Rückbau befindliche Kernkraftwerk Stade - beim NLWKN in Hildesheim - hier ist seit 2007 das Kompetenzzentrum für den Strahlenschutz untergebracht. Erst 2008 wurde die Datenübertragung umfassend modernisiert.
In den ersten Jahren erstreckte sich die Emissionsüberwachung auf die Kernkraftwerke Stade und Unterweser. In den Jahren 1984 und 1986 wurden schon mit Aufnahme des Betriebs die Kernkraftwerke Grohnde und Emsland in das Kernreaktor-Fernüberwachungs-System integriert, 1987 wurde erstmals eine Alarmierungsfunktion per Telefonkette eingerichtet. Seit 1991 werden in der Umgebung der Kernkraftwerke zusätzlich Messsonden eingesetzt, mit denen der Strahlungspegel kontinuierlich gemessen wird.
Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 wurde vom Bund das integrierte Mess- und Informationssystem (IMIS) zur Erfassung der Umweltradioaktivität eingerichtet, seit 1989 befinden sich die IMIS-Landeszentrale mit Zugriff auf alle Daten zur Umweltradioaktivität und die Zentrale der niedersächsischen Kernreaktor-Fernüberwachung unter einem Dach in Hildesheim.
Bei einem Störfall würde der NLWKN nicht allein stehen: Niedersachsen verfügt wie andere Bundesländer auch über einen Zugang zu „RODOS". RODOS ist das Entscheidungshilfesystem des Bundes bei kerntechnischen Not- und Unfällen und wird vom Bundesamt für Strahlenschutz betrieben. „Im Falle einer radioaktiven Freisetzung hilft RODOS die erforderlichen Maßnahmen vorzuplanen", erläuterte Popp.
Was wird genau überwacht? „Zunächst einmal alles, was durch den Kamin in die Luft geht", erläuterte Dr. Hauke Brüggemeyer vom NLWKN in Hildesheim und ergänzt: „Da geht nichts raus, ohne das wir das merken". Zur Emissionsüberwachung befinden sich in jeder Anlage neben den betreibereigenen Messgeräten auch landeseigene Monitore des NLWKN, die kontinuierlich die Abgabe radioaktiver Stoffe in Form von Edelgasen, Aerosolen (an fein verteilten Schwebstoffen gebundene radioaktive Stoffe) und Jod (Nuklid J-131) im Abluftkamin bestimmen. Auch das gesamte Kühl- und Abwasser wird kontinuierlich auf die Abgabe radioaktiver Stoffe hin überwacht; außerdem werden zusätzlich Proben des abgeleiteten Wassers im radiologischen Labor des NLWKN untersucht. Weitere Betriebswerte des Kernkraftwerkes sowie die Daten der betreibereigenen meteorologischen Messstation werden ebenfalls erfasst. Alle Messwerte werden im Zehn-Minuten-Takt an die Zentrale in Hildesheim weitergeleitet und ausgewertet. „Damit stellt der NLWKN für das Land eine betreiber-unabhängige kontinuierliche messtechnische Überwachung der Emission aller Kernkraftwerke in Niedersachsen sicher", betonte Popp.
Infos zum Jahresbericht gibt es hier!