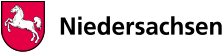Umweltminister Meyer will Wassergesetz modernisieren: „Mehr Klimaanpassung, schnellere Genehmigungen und verantwortungsvoller Umgang mit Wasser“
PI 050/2025
Umweltminister Christian Meyer hat am (heutigen) Mittwoch seine Pläne zur Änderung des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) vorgestellt. Damit reagiert die Landesregierung auf die Herausforderungen des Klimawandels beim Wasserhaushalt und schafft gleichzeitig schnellere und einfachere Zulassungsverfahren. Der Gesetzesentwurf wurde kürzlich vom Kabinett beschlossen.
„Die Klimakrise bringt auch eine Wasserkrise mit sich. Die Klimaerwärmung führt zu zunehmender Hitze und Verdunstung sowie zu vermehrten Dürren und Überschwemmungen. Auch der Verbrauch steigt. Dadurch sinken unsere wertvollen Grundwasserreserven. Wasser wird knapper und damit immer begehrter. Mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf reagieren wir darauf und machen unsere Wasserversorgung zukunftsfest“, so Minister Meyer. „Wir müssen bei Genehmigungen schneller und zielgerichteter werden – besonders wenn es um Hochwasserschutz und natur- und klimafreundliche Maßnahmen auf und am Wasser geht. Alle Maßnahmen des natürlichen und technischen Hochwasser- und Küstenschutzes haben in Zukunft Vorrang vor anderen Interessen. Unser Ziel ist ein modernes Wasserrecht, das uns sowohl auf zu viel Wasser als auch auf zu wenig Wasser vorbereitet. So sichern wir langfristig die Ressource Wasser für Menschen, Landwirtschaft und Natur.“
Der neue Entwurf, der sich jetzt in der Verbandsanhörung befindet, sieht unter anderem vor:
Deichbau- und sonstige Hochwasserschutzvorhaben sollen künftig im überragenden öffentlichen Interesse liegen und damit Vorrang vor anderen Interessen wie Denkmalschutz, Landschaftsbild oder Bodennutzung genießen. Das Umweltministerium plant außerdem die Einführung eines digitalen Registers, das alle Deiche und Schutzanlagen bündelt und die Zusammenarbeit verbessert.
Vereinfachte Genehmigungen: Unter bestimmten Voraussetzungen sollen künftig langwierige Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren für Ausbauprojekte, die den ökologischen Zustand der Gewässer verbessern oder Moore und Feuchtgebiete wiedervernässen, entfallen. So soll Naturschutz und Gewässerentwicklung einfacher und schneller realisierbar werden, wenn etwa wieder mehr natürliche Auen, renaturierte Flussläufe und Überschwemmungsflächen angelegt werden. Auch Maßnahmen, durch die Niederschlagswasser besser versickern kann, sollen einfacher und schneller umgesetzt werden können.
Erleichterungen für die Transformation in Häfen: Der Ausbau von Anlagen für Grüne Gase, Wasserstoffproduktion sowie für Batterie- und Elektromobilität kann künftig deutlich unkomplizierter und zügiger umgesetzt werden. Die Landesregierung erhofft sich dadurch einen starken Schub für Klimaschutz und nachhaltige Transformation für die Energiewende.
Innovationen: Neuerungen wie fischfreundliche Wasserkraftanlagen, Floating-Solarparks auf Gewässern oder Wärmepumpen, die die natürliche Wärme von Seen und Flüssen nutzen, profitieren von erleichterten Zulassungen. Damit fördert das Gesetz den Ausbau sauberer Energiequellen – für eine nachhaltige und zukunftsfähige Wasserwirtschaft. Außerdem sollen Wasserentnahmen, die bisher ohne Genehmigung möglich waren, künftig gemeldet und geprüft werden müssen – so soll die Ressource Wasser besser geschützt und genutzt werden.
„Für Wasserentnahmen führen wir erstmals einen Klimafaktor ein. Die Wasserentnahmen dürfen in Zukunft nur erfolgen, wenn auch unter veränderten Klimabedingungen im jeweiligen Grundwasserkörper nicht mehr Wasser entnommen wird als sich nachbildet. So schützen wir unser Grundwasser für kommende Generationen“, so Minister Meyer. In besonders belasteten Grundwassergebieten bekommen die Behörden mehr Handlungsspielraum, um im Notfall Entnahmerechte und Verbrauch einzuschränken. Landwirtschaftliche Beregnungsverbände sollen gestärkt werden, damit Landwirte ihre Wassernutzung besser koordinieren können. Außerdem wird künftig die wichtige Rolle der Wälder für Klima und Wasserwirtschaft ausdrücklich anerkannt. Für Waldflächen soll es daher wegen ihrer Klimaschutz- und Wasserrückhaltewirkung einen verringerten Beitrag bei den Wasser- und Bodenverbänden geben.
Als Pilotprojekt fördert das Umweltministerium etwa im Wasserschutzgebiet Glanebachtal bei Osnabrück die Aufforstung einer kalamitätszerstörten Nadelwaldfläche zu 21 Hektar „Wasserwald“ mit Laubbaumarten, die die Wasserneubildung besonders stärken.
Das Umweltministerium plant zudem gemeinsam mit dem Landwirtschaftsministerium eine neue Förderrichtlinie zur Stützung der Grundwasserressourcen und der Feldberegnung. Damit werden Investitionen in Wasserrückhalt wie z. B. eine wasserschonende Drainagensteuerung, die Verrieselung von Prozesswasser, Entsiegelungen oder andere Maßnahmen zur Erhöhung der Wasserspeicherfähigkeit des Bodens gesondert gefördert. Als erster Schritt sind 35 Millionen Euro für diese neue Richtlinie zum Wasserrückhalt aus dem MU-Haushalt vorgesehen.
Zusätzlich zu dieser neuen Richtlinie sind weitere 100 Millionen Euro aus dem Länderanteil des Sondervermögens „Infrastruktur und Klimaneutralität“ des Bundes für Investitionen in die Wasserwirtschaft, den Hochwasser- und Küstenschutz sowie für wasserwirtschaftliche Anlagen vorgesehen.
Damit mehr Wasser eingespart wird, sollen Gemeinden künftig Zisternensatzungen erlassen können – so können Regen- und Grauwasser besser gesammelt und genutzt werden. Wasserversorger werden ermächtigt, Anreize für sparsamen Wasserverbrauch zu schaffen, etwa durch eine angepasste Preisgestaltung. So können dann etwa Familien mit Kindern eine verringerte Gebühr für den Grundbedarf zahlen, während Verbraucher mit besonders hohem Wasserverbrauch etwas mehr zahlen müssten. „Wasser sparen oder die Nutzung von Brauch- und Regenwasser lohnt sich dann besonders“, so Meyer.
Ein weiterer wichtiger Punkt: Um die Trinkwasserressourcen zu schützen, soll das Bohren nach Erdöl und Erdgas in Wasserschutzgebieten zukünftig verboten werden.
Zum Hintergrund:
Erwartete Gesamtentnahmen aus dem Grundwasser durch verschiedene Nutzergruppen in Niedersachsen (Kubikmeter pro Jahr; Quelle: MU)
|
Nutzung für: |
Ist-Zustand 2015 |
Annahme 2050 |
|
Öffentliche Wasserversorgung |
Ca. 747 Mio. |
Ca. 815 Mio. |
|
Landwirtschaftliche Feldberegnung |
Ca. 254 Mio. |
Ca. 598 Mio. |
|
Industrie (Eigenversorgung) |
Ca. 205 Mio. |
Ca. 211 Mio. |
Den Gesetzentwurf finden Sie hier .
Artikel-Informationen
erstellt am:
09.07.2025
zuletzt aktualisiert am:
10.07.2025