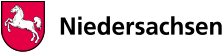Einfluss von Abfallzusammensetzung, Verfahrenstechnik und Anlagenbetrieb
Dr.-Ing. Ketel Ketelsen, iba GmbH
Die jeweiligen Abbildungen finden Sie in der zugehörigen > Präsentation (PDF, 205 KB)
1. Vorbemerkung
Die in den vergangenen Monaten kommunizierten Probleme bei der Inbetriebnahme von MBA fokussierten sich auf den Problemparameter TOCEluat, auf unzureichende Verfügbarkeit auf Grund Mängel technischer Komponenten und Absatzprobleme bei der heizwertreichen Fraktion.
Nachfolgend werden mögliche Ursachen der Probleme und Optimierungsansätze diskutiert.
2. Bemessung der Gesamtanlagen
Durchsatz
Die Auslegung der Anlagen erfolgte i. d. R. auf der Grundlage von Abfallprognosen aus den Jahren 2000 ff für das Jahr 2005 ff. Im Verlauf der Planung und Ausschreibung haben sich die künftigen Anlagenbetreiber teilweise noch um Kooperationspartner und Mengen beworben zum Teil fielen Vergabeentscheidungen um Mengenkontingente erst nach der Vergabe der Anlagentechnik.
Die Hauptschwierigkeit bei der Anlagenauslegung lag im Problem der Prognose der nach dem 31.05.2005 bei den Kommunen weiter oder wieder angedienten gewerblichen Abfallmengen und deren Qualität.
Die Auswirkungen des Schicksalstages 31.05.2005 fielen in den Gebietskörperschaften unterschiedlich aus. Sie erstrecken sich vom Wegbrechen weiterer Abfallmengen auch gerade im Umleerbehälterbereich, über die Prognosepunktlandung bis hin zur erheblichen Überschreitung der gewerblichen Prognosemengen.
Letzteres wurde hervorgerufen durch die "unerwarteten" Entsorgungsprobleme denen sich einige private Entsorger am 01.06.2005 konfrontiert sahen.
Verfahren und Behandlungszeiten
Die Anlagen wurden von Ausnahmefällen abgesehen verfahrensoffen ausgeschrieben.
Lediglich im Bereich der Mechanischen Aufbereitung wurden Vorgaben zur gewünschten Aufbereitungstiefe für die heizwertreiche Fraktion sowie zur Anzahl der Behandlungslinien gemacht.
Die Auslegung der Anlage sowie die Wahl der Aggregate und des Verfahrens insbesondere in der biologischen Stufe wurde den Verfahrens-Anbietern überlassen.
Die Bieter- und damit die Verfahrensauswahl erfolgte damit i. d. R. im Rahmen des Vergabeverfahrens nach technischer Klärung vorrangig nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Die Gewährleistung für die Funktionalität der Anlagentechnik und damit Einhaltung der Grenzwerte oblag damit den beauftragten Anlagenerrichtern.
Eine Auswahl der realisierten MBA-Konzepte zeigen Abb. 1 und 2.
Abb. 1 (Folie 4): Grundzüge der mechanischen Aufbereitung in MBA mit Darstellung, Herkunft und Verbleib der Feinfraktion
Abb. 2 (Folie 5): Übersicht über realisierte biologische Verfahrenskombinationen bei den MBA
- Realisiert wurden nach 2001 überwiegend
- Intensivrotte im Tunnel mit belüfteter Nachrote als Zeile oder Wandermiete,
- wie a), jedoch Nachrotte ohne Zwangsbelüftung in Tafel- oder Dreiecksmieten,
- Trockenvergärung für Teilstrom mit Nachrotte im Tunnel oder Wandermiete,
- wie c), jedoch Vergärung für Gesamtstrom,
- Nassvergärung mit aerober Stabilisierung in der Flüssigphase sowie Entwässerung und thermischer Trocknung der Gärreste.
Die Behandlungszeiten differenzieren zwischen 5 und 13 Wochen abhängig vom Verfahren und Verfahrensanbieter (Abb. 3).
Abb. 3 (Folie 6): Aufenthaltszeiten in den biologischen Stufen von MBA bei unterschiedlichen Verfahren
Getrennte Andienung von Abfallarten
Die MBA-Technik basiert mit ihrem Ansatz einer stoffstromspezifischen Abfallbehandlung auf dem Grundsatz einer nach Abfallarten getrennten Abfallaufbereitung. Dies erfordert im Vorfeld ein Mindestmaß an Getrennthaltung der Abfallarten bei Umschlag und Transport. Gerade aus dem Bereich von Umschlaganlagen von Drittanlieferern wurden und werden über großvolumige Schubbodenfahrzeuge Abfallgemische aus Hausmüll, Sperrmüll, Gewerbeabfall, Sortierresten und manchmal auch sonstige Abfälle angeliefert, die auf Grund ihrer Zusammensetzung und Qualität in den Anlagen zu Problemen führen.
Auf Grund ihrer Vermischung können diese Abfälle nicht über die Hausmüll-Linie gefahren werden.
Durch zwangsweise Aufgabe auf die Gewerbeabfall-Linie kann die im Gemisch enthaltene organikhaltige Feinfraktion nicht mehr zur biologischen Stufe geleitet werden, sondern belastet hinsichtlich Menge und Qualität die heizwertreiche Fraktion. Um das wirtschaftliche Ergebnis der MBA zu optimieren sind entsprechende Vorgaben und deren Umsetzung an die Sammel- und Transportlogistik im Vorfeld der Anlage erforderlich.
3. Einfluss der Abfallzusammensetzung
- Die Abfallzusammensetzung übt Einfluss auf zwei Ebenen aus:
- Menge und Qualität der organikhaltigen Feinfraktion
- Menge und Qualität der heizwertreichen Fraktion
Insbesondere bei feuchten Abfällen reduziert sich der abtrennbare organische Feinkornanteil. Die feuchten Feinkornanteile gelangen als Haftkorn in die heizwertreiche Fraktion und erhöhen deren Menge und verschlechtern deren Qualität (Heizwert!). Dieser Effekt wird verstärkt durch die o. g. Anlieferungen von vermischten Abfällen. Diese Effekte beeinflussen über die Stoffstromaufteilung und ggf. Unterauslastung der biologischen Stufe das wirtschaftliche Ergebnis der MBA; nicht dagegen das Behandlungsergebnis der biologischen Stufe und ist von daher nicht Gegenstand dieses Workshops.
- Die Qualität der organischen Feinfraktion bestimmt dagegen direkt das Behandlungsergebnis bzgl. AbfAblV:
- Höhe der biologischen Aktivität gemessen an AT4, GB21, TOCEluat.
- Anteil an Störstoffen, die die Verfügbarkeit der Anlage reduzieren.
- Anteil an Hemmstoffen, die den biologischen Prozess (vorrangig bei Vergärungsanlagen) nachhaltig stören.
Den Punkten 1b und 1c ist durch entsprechende Trenntechniken (Schwerstoffabtrennung vor der Trockenvergärung), Zuführung mineralikhaltiger Abfälle direkt zur Rotte oder Abweisung belasteter Abfälle und Abfällen aus dem Baustellenbereich (Gipskartonplatten führen z. B. zum drastischen Anstieg der H2S-Gehalte im Biogas) Rechnung zu tragen.
Die Qualität der Feinfraktion aus Hausmüll ist abfallimmanent und durch den Aufbereitungsprozess nur sehr bedingt beeinfllussbar.
Eine Ausnahme stellt hier nur die Aufbereitung mittels Kugelmühle dar, die jedoch nur in Einzelfällen realisiert wurde.
In der Regel wird die Feinfraktion in MBA aus Hausmüll durch Vorzerkleinerung des Abfalls und nachfolgende Siebung gewonnen (Abb. 1).
Hinsichtlich des Siebschnittes unterscheiden sich die Anlagen (Bereich < 40 bis < 80 mm).
- Bei den biologischen Aktivitätsparametern haben sich starke regionale Unterschiede rausgestellt:
AT4: 40 bis 70 mgO2/gTS
TOCEluat: 2.000 bis 4.000 mgO2/gTS
mit erheblichen Schwankungsbreiten bei der analytischen Bestimmung von Inputproben.
Während die AT4-Werte im Erwartungsbereich liegen, liegen die analysierten TOCEluat-Werte bei einigen Anlagen zum Teil deutlich über den aus früheren Untersuchungen bekannten Werten.
Eine Erklärung für diesen Effekt gibt es bisher noch nicht.
Von Interesse ist dabei vorrangig, ob die Höhe der AT4- und TOCEluat-Werte im Eintrag zur Biologie das Behandlungsergebnis bestimmen sowie die erforderliche Behandlungszeit beeinflussen.
Bei Vergärungsanlagen wurde die höhere biologische Aktivität durch eine höhere Biogasausbeute aufgefangen.
Bei reinen Rotteanlagen verkürzt sich mit abnehmendem AT4-Startwert die Zeit bis zum Erreichen des Zuordnungswertes für die offene Nachrotte (AT4 < 20 mg/gTS), innerhalb der planmäßigen Aufenthaltszeit im Tunnelsystem von 5-6 Wochen haben sich die Anfangsunterschiede jedoch ausgeglichen. D. h., das Tunnelsystem kann bei entsprechender Auslegung im Belüftungssystem Unterschiede in der Abfallqualität ausgleichen. Bei geringerer Bewirtschaftungsintensität in der Intensivrotte (reduzierte Anzahl Umsetzvorgänge, geringere Lüftungsraten, etc.) erhöht sich der AT4-Wert im Austrag der Intensivrotte trotz geringerem Startwert (Anlage C in Abb. 4).
Abb. 4 (Folie 8): Entwicklung der Atmungsaktivität im Verlauf der Rotte bei unterschiedlichen Startwerten und unterschiedlichen Rottesystemen
Beim TOCEuat-/DOC-Wert ist das Bild uneinheitlicher.
Nach Auswertung von prozessbegleitender Analytik während Inbetriebnahme und Probebetrieb konnte in mehreren Anlagen kein direkter Zusammenhang zwischen TOCEluat-Werten im Eintrag und im Austrag der Intensivrotte festgestellt werden (Abb. 5).
Das Ergebnis im Austrag der Intensivrotte wurde maßgeblich bestimmt von der Bewirtschaftung der Tunnel hinsichtlich Belüftung, Bewässerung und Temperaturführung.
Unzureichende Prozessergebnisse in der Intensivrotte können in der Nachrotte in der regulären Behandlungszeit nicht mehr aufgefangen werden.
Abb. 5 (Folie 9): TOCEluat im Ein- und Austrag der Intensivrotte (Beispiel) (Wertepaare aus Chargenverfolgung der Größe der Austragswerte nach geordnet)
4. Einfluss der Verfahrenstechnik auf das Behandlungsergebnis
Nach dem bisher vorliegenden Betriebsergebnissen und Laborwerten lassen sich hinsichtlich Einhaltung der Grenzwerte der AbfAblV keine grundsätzlichen auf die gewählte Verfahrenstechnik zurückzuführenden Unterschiede erkennen.
Tendenziell sind bei bestimmungsgemäßen Betrieb die Ablagerungswerte von Vergärungsanlagen (trocken, Teilstrom) mit Nachrotte im Tunnel schon kurz nach Inbetriebnahme am sichersten eingehalten worden.
Die reinen Aerob-Anlagen haben sich als anfälliger gegenüber Veränderungen in der Prozessführung erwiesen, verstärkt durch die geringen zur Verfügung stehenden Luftmengen letztlich eine Folge der Anforderungen der 30. BImSchV hinsichtlich Abluftminimierung.
Störungen in der Prozessführung schlagen unmittelbar auf das Behandlungsergebnis durch, wobei der TOC-Eluat / DOC-Wert stärker beeinflusst wird als der AT4-Wert.
Die in Abb. 6 dargestellten Schwankungen beim TOCEluat-Wert spiegeln sich auch beim Verlauf der AT4-Werte wider, jedoch liegen sie in diesem Fall alle unter dem gesetzlichen Grenzwert.
Abb. 6 (Folie 10): Zeitliche Entwicklung der TOCEluat-Werte im Austrag einer MBA mit Rotte nach Inbetriebnahme
Als neuralgischer Punkt und Flaschenhals für die Abführung der Abluftmengen aus der Rotte haben sich die RTO-Anlagen erwiesen. Verblockungen in den Keramikfüllkörpern, hervorgerufen durch Ablagerungen von SiO2, führen in den Anlagen nach einer bestimmten Betriebszeit zu einem Anstieg der Druckverluste über die Betthöhe und in der Folge zu einer zum Teil drastischen Reduktion der Durchsatzmengen.
Durch die Probleme in der RTO kann die Intensivrotte nicht mehr mit ausreichenden Luftmengen versorgt werden. Der gewünschte biologische Abbau in der Intensivrotte wird nicht mehr erreicht, der Abbau verlagert sich in nachfolgende Nachrottesysteme, die dafür nicht ausgelegt sind. In der Folge werden die Ablagerungswerte in der regulären Rottezeit nicht mehr erreicht und die betroffenen Chargen müssen länger nachrotten.
In einigen Anlagen wurde daraufhin die RTO-Kapazität um eine dritte Linie erweitert, in anderen Anlagen wies die RTO noch die erforderlichen Leistungsreserven auf, um auch mit Ablagerungen zum Zeitpunkt der Reinigung noch die geforderten Abluftmengen zu behandeln.
5. Optimierungsansätze
Optimierungsansätze sind nur individuell auf den jeweiligen Einzelfall der Anlagen bezogen abzuleiten. Dabei führen Veränderungen in der mechanischen Stufe nicht unmittelbar zu einer Verbesserung der biologischen Abbaubarkeit der Feinfraktion.
Sofern Probleme in der biologischen Stufe auf eine zu geringe Struktur zurückzuführen sind, kann mit Erweiterung des Siebschnittes die Struktur verbessert werden, vorausgesetzt die nachfolgende biologische Stufe kann die daraus resultierenden Mehrmengen auch aufnehmen.
Eine weitergehendere Abtrennung von Störstoffen aus der Feinfraktion betrifft i. W. Vergärungsanlagen, bei Anlagen mit Nassvergärung ist dies verfahrensspezifisch erforderlich (Abtrennung von Sink- und Schwimmstoffen aus der Suspension von der Vergärung) und schon Verfahrensbestandteil.
Sofern die mechanische Stufe die geforderten Durchsatzmengen nicht erbringt, was m. E. eher der seltene Fall ist, liegt es zumeist an der mangelnden Eignung von Einzelaggregaten oder Einzelkomponenten, die zu einer Reduktion der Anlagenverfügbarkeit führen. Diese Aggregate müssen dann soweit möglich optimiert oder ausgetauscht werden.
In den biologischen Stufen wird das Behandlungsergebnis maßgebend von der Prozessführung bestimmt. Optimierungsansätze liegen bei Aerobsystemen hier vorwiegend im Bereich Belüftung, Bewässerung und Bewirtschaftung.
Durch ausreichende Belüftung und Bewässerung muss vorrangig die erzeugte Wärme aus dem Prozess abgeführt werden, um die Mietentemperaturen im optimalen Bereich von 55-60°C halten zu können.
Je kürzer die Rottezeit und je intensiver der Abbauprozess, desto eher ist der Wärmeaustrag nicht mehr nur über den Abluftpfad sicherzustellen, sondern erfordert eine Kühlung der Umluft.
Um die Wärme mit möglichst geringer Abluftmenge abführen zu können, muss die Abluft wasserdampfgesättigt sein (dies wird in Tunnelsystemen durch entsprechende Umluftführung sichergestellt). Mit Anstieg der Ablufttemperatur steigt jedoch die Feuchte in der Abluft exponentiell an, so dass die Mieten zu stark austrocknen und sich schlecht wieder bewässern lassen.
Voraussetzung für eine optimale Belüftung der Mieten ist, dass die vom biologischen Prozess im Rahmen der Steuerung abgeforderte Luft auch sicher abgeführt und behandelt werden können (s. o., RTO).
Mit der 30. BImSchV haben sich die Gesetzmäßigkeiten des biologischen Abbaus nicht verändert, die Voraussetzungen für die Sicherstellung und Aufrechterhaltung optimaler Prozessbedingungen haben sich jedoch durch den auf die TOC-/N2O-Frachtenregelungen der 30. BImSchV zurückzuführenden Zwang zur Abluftminimierung verschärft.
Teilweise führte der gewählte minimierte Luftmengenansatz dazu, dass der Prozess zu anfällig gegenüber Störungen reagierte und Emissionsquellen in den Hallen nicht mehr genügend abgesaugt wurden.
Dies wurde in der Folge durch noch weitergehendere Kapselung von Emissionsbereichen und Erhöhung der Gesamtluftmengen aufgefangen.
6. Anpassung der TOC / DOC-Grenzwerte
Mit Novellierung der AbfAblV und Anhebung des TOC / DOC-Zuordnungswertes von 250 auf 300 mg/l (als Median) und Erhöhung des Überwachungswertes von 300 auf 600 mg/l (als 80.Perzentil) trägt der Gesetzgeber sowohl der aus aktuellen Betriebsergebnissen ermittelten Korrelation zwischen AT4 und TOC / DOC sowie den in der Praxis aufgetretenen Schwankungen bei der analytischen Bestimmung Rechnung.
Nach Auswertung von Betriebsergebnissen aus zwölf MBA errechnet sich für einen AT4-Wert von 5 mg/gTS ein korrespondierender TOCEluat / DOC-Wert von 350 mg/l. Durch die Grenzwertanhebung auf DOC=300 mg/l muss demnach ein AT4-Wert von im Mittel < 4 mg/gTS eingehalten werden.
Die im Rahmen von Ringanalysen aufgetretenen Schwankungsbreiten sowie die Auswirkungen der Grenzwertanpassung auf die Bewertung der Analysenergebnisse zeigt beispielhaft Abb. 7.
Abb. 7 (Folie 12): Darstellung der zulässigen Überschreitungsregelungen nach AbfAblV und der Auswirkungen der Grenzwertanhebung 2006 beim TOCEluat bei der Bewertung der Messergebnisse aus einer Vergleichsanlage
Mit der Anhebung des 80.Perzentilwertes auf 600 mg/l wird den Anlagenbetreibern eine höhere Sicherheit vor laboranalytischen Schwankungsbreiten eingeräumt und den Überwachungsbehörden der Vollzug der AbfAblV erleichtert.
Autor:
Dr.-Ing. Ketel Ketelsen
Friesenstraße 14, 30161 Hannover
E-Mail: iba@iba-hannover.de

Artikel-Informationen
erstellt am:
29.11.2006
zuletzt aktualisiert am:
16.03.2010